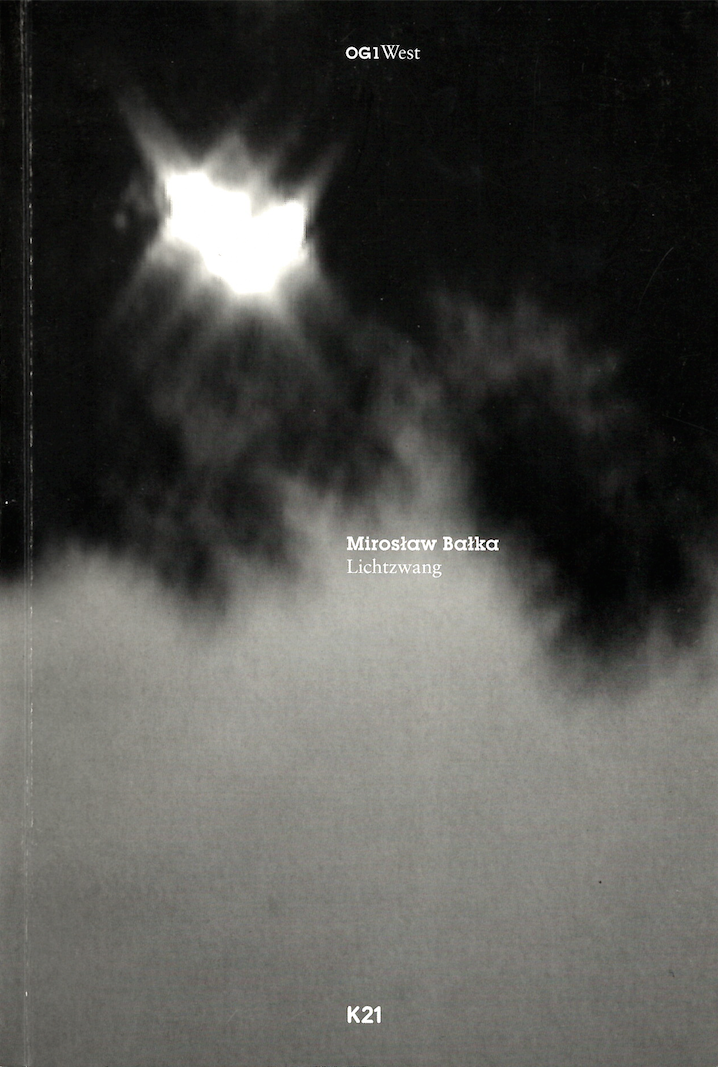Lichtwerk
Eine Holzplanke, etwas Filz, ein Gang aus Beton, ein Stück Seife, ein alter Fußball, eine Hand voll Salz oder eben auch ein paar Minuten Videofilm, vielleicht auch weniger. Die Materialbeschaffung ist für Mirosław Bałka kein Problem, und Bilder gibt es überall, man muss sie nur sehen und zu gebrauchen wissen. Es sind allerdings nicht irgendwelche Bilder, die man so am Wegesrand auflesen kann. Ganz gleich, ob sie sich plötzlich aufdrängen oder sich eher beiläufig ins Bewusstsein schieben, man findet sie, weil sie einem vertraut sind, ohne dass man sie zuvor je so gesehen hätte. Wirklich suchen kann man diese Bilder nicht, höchstens dass man sich an Orte begibt, wo sie sich möglicherweise aufhalten. Stößt man aber auf sie, sind sie unmittelbar klar und einleuchtend. Man muss nur die kleine Kamera aus der Tasche holen und eine Zeit lang filmen. So zum Beispiel wenn der Schnellzug durch die baumbestandene Gegend saust, der Wind an den offenen Fenstern bullert, zischt und rüttelt und man auf einmal in den zuckenden Sonnenflecken auf dem Fußboden ein Insekt sieht, das auf den Rücken gefallen ist und irrsinnig schnell mit den Flügeln schlägt, um sich wieder in die richtige Lage zu bringen und fort zu fliegen. Eine Minute Film ist da schon eine kleine Ewigkeit, und auch wenn er nichts weiter zeigt als das rasende, torkelnde Lebewesen wissen wir: Es wird nicht davonkommen. Nur der Film kann wieder von vorne beginnen, ohne dass man es sogleich merkt.
Was hier auf einer Bahnfahrt entdeckt und ohne große Vorbereitung in einer Einstellung aufgenommen wurde, ist ein kaum gefiltertes Stück Leben, das unmittelbar hergestellte Dokument einer zu einem Bild verdichteten Situation. Wir sehen das kämpfende Insekt, wir hören den fahrenden Zug und wir spüren seine schlingernde Bewegung. Die Kunstfertigkeit liegt nicht im filmischen Handwerk, denn das Licht ist unzuverlässig, die Kamera nur von mittlerer Qualität, und das Bild wackelt. Das, was man sieht, ist nicht zu trennen von dem, wie es gesehen wird und wer es sieht. Subjektivität, wenn denn dies das richtige Wort sein sollte, ist hier Methode. Dokumentation ist Zeugenschaft, also Verknüpfung, Verstrickung.
Dieser und die anderen Filme setzen irgendwo ein und laufen dann als Schleife weiter. Kleinere Handlungsfetzen, die man zu erkennen glaubt, und jeder Ansatz zu einem dramatischen Verlauf werden sogleich wieder aufgelöst und in etwas überführt, das man Zustand nennen könnte. Aus der Beobachtung wird eine Situation, wird ein Zustand – wird ein Statement? Wir werden sehen.
Die Filme werden im Raum sichtbar. Sie kommen heraus aus der Maßstabslosigkeit des rechteckigen Filmbildes, das irgendwo zwischen Großkino und Minimonitor existiert. Die flüchtige Existenz der Bilder aus Licht wirft Anker in der physischen Realität. Bałkas Filme teilen den Raum mit unseren Körpern. Sie haften an Türen, sie schmiegen sich in Ecken, sie liegen auf dem Boden und, selbst wenn sie, wie gewohnt, auf der Wand vor uns erscheinen, suchen sie Kontakt zu etwas Realem, zu einem Stück Material, zu etwas, das man anfassen kann. So leicht, so bildlich, so fiktional die Filme sind, sie kommen der Skulptur so nahe wie möglich, wie Vettern.
Narayama
Nur ein paar Einzelbilder, wie aus einem Film. Langsam wechseln sie auf einem Bildschirm in der Wand. Es ist der gleiche Bildschirm, der an anderen Stellen des Museums diskret den Weg zur Sammlung weist. Die Bilder verfolgen einen großen Sandhaufen, der sich auf einer Straße durch Wälder und durch einen Ort zu bewegen scheint. Gerade eben nur erkennt man, dass er auf der offenen Pritsche eines Lastwagens liegt. Manchmal rückt er so nah heran, dass man ihn einen Moment lang für einen Berg halten könnte. In paradoxer Weise dehnen die wechselnden Bilder die Zeit, obwohl sie den Lauf einer möglichen Handlung doch auf wenige Momente verkürzen. Aber diese Aufnahmen genügen, um sich einen Weg, eine Strecke zu denken. Es geschieht so gut wie nichts; man sieht Baumkronen, Telefonleitungen, Lichtmasten, mal ein Verkehrsschild – auch einmal Häuser. Nur einmal nähert sich der Spitze des Sandberges ein Vogel und fliegt wieder weg. Auch in einem solchen Moment bleibt die Szene ganz nah am Alltäglichen. Nie täuschen die Bilder darüber hinweg, dass es nur um die Verfolgung eines Lastwagens mit einer Ladung Sand geht. Die poetischen Augenblicke, diejenigen, in denen sich die Beobachtung davonstiehlt und mehr und anderes sieht als ein beliebiges Vorkommnis auf der Straße, bleiben unter der Oberfläche. Aber sie sind präsent und sie konzentrieren sich auf den Sandhaufen, den die Vorstellungskraft zu einem wandernden Berg macht. Der Lastwagen fährt durch Otwock, den Ort, wo seit langem das Studio des Künstlers ist. Der Erdboden ist sandig hier in der Weichselniederung. Wird die Ladung auf der Pritsche zu einer Baustelle gefahren? Oder soll damit nur eine Grube zugeschüttet werden? Woher stammt der Sand? Vom Rande jenes verlassenen jüdischen Friedhofs, dessen lockerer Grund noch bis vor nicht allzu langer Zeit immer wieder Gebeine freigab?
Die Bilder verweigern die Antwort auf solch konkrete Fragen, die in ihre Realität eindringen wollen. Stattdessen lassen sie Gedankenlinien entstehen, lose Verbindungen, die den Künstler haben zur Kamera greifen lassen, als er den Sand auf dem fahrenden Lastwagen sah, und denen er am Ende mit dem Titel eine Richtung gegeben hat. Narayama ist der Name eines heiligen Berges, der die zentrale Metapher in einer Erzählung von Shichiro Fukazawa (1957) und zwei auf ihr basierenden Filmen von Keisuke Kinoshita (1959) und Shohei Imamura (1983) ist. Die Geschichte spielt in einem armen japanischen Bergdorf, in dem es die Not und die Tradition will, dass sich die Alten, wenn sie siebzig werden, auf dem Rücken ihrer Söhne aufmachen, um allein auf dem Berg Narayama zu sterben. Die Hauptfigur Orin vollzieht diesen Abschied in großer Verantwortung, Bewusstheit und Ruhe.
Die wenigen Bilder auf dem Monitor am Eingang zur Ausstellung sind keine Illustration dieser Geschichte. In ihnen sind höchstens einige Elemente der Erzählung in gleichsam versteckter Form und vertauschter Anordnung präsent. So gerafft und beiläufig die Bilder erscheinen, könnte man sie vielleicht mit einer Vignette oder einer Initiale in einem Buch vergleichen. Auch dort verbirgt sich in einem kleinen Bild eine Andeutung, ein fragiler Hinweis. Die Gedankenkette läuft von der Gestalt des Sandhaufens über die Vorstellung des heiligen Berges zu jener konkreten japanischen Geschichte und dann weiter zum Tod, zum richtigen Tod, zum eigenen Tod. Es ist eine Kette, die an einer fast beliebigen Stelle ansetzt, durch Assoziationen weitergetragen wird und schließlich an einem ganz harten Punkt aufläuft. Die Sprünge, die das Auge und mit ihm die Gedanken dabei machen, sind groß, aber realistisch. Es bedarf nur weniger Signale, uni unter der Oberfläche des Banalen auf die nagenden Fragen zu stoßen. Früher hat man so etwas ein memento mori genannt, eine fundamentale Erinnerung im Vorübergehen. Mit der Kunst des Sterbens zu beginnen, ist kein schlechter Anfang.
BlueGasEyes
Man erkennt das Bild sofort. Wer einmal einen Gasherd gesehen hat, dem sind die blau leuchtenden Flammenkränze vertraut, deren Pulsieren von einem leisen Zischen begleitet wird. Dann und wann bringt eine kleine Stockung in der Gaszufuhr die Flammen ein wenig aus dem Takt, ein Luftzug kann sie ablenken, und mitunter verursachen Rußpartikel kleine, flüchtige, gelb-rote Explosionen. Wie bei jedem Blick in ein Feuer werden auch hier Vorstellungen von Wärme, Geborgenheit, Reinheit, aber auch von Zerstörung oder Melancholie angestoßen. Für den einen ist der Anblick von Flammen emotional besetzt und rührt an das Wechselspiel von heimlich und unheimlich, für den anderen sind sie eher ein suggestiver, aber neutraler Anlass für Denken und Sinnen. Die in ein geometrisches Ornament gezwungenen Flammen des Herdes erweitern das Feld der Assoziationen in Richtung Schmuck, Pracht, Symbol: „a burning ring of fire“. Immer aber bewirkt das verführerische und bedrohliche Element eine gesteigerte Aufmerksamkeit; in ihm steckt etwas Dringliches. Sein ‚Leben' ist eben notwendig an Vernichtung gebunden.
Die Projektion des Films folgt seiner Aufnahmesituation. So wie die Kamera die brennende Herdstelle von oben gefilmt hat, so sieht man jetzt den Flammenkranz unten auf dem Boden. Manchmal wird das Bild leicht unscharf, es zittert, und einmal springt das Motiv auch für einen Moment aus seiner zentralen Position heraus. Diese Unzulänglichkeiten verbinden das Erlebnis des Films direkt mit seiner Entstehung. Man merkt die Anstrengung der Hand, die die Kamera frei über dem Herd hält, man spürt sozusagen die Hitze, die von den Flammen zum Gesicht des Filmenden aufsteigt und die er die dreieinhalb Minuten dieser Aufnahme lang aushält, so gut es geht. Das Bild vor einem auf dem Boden ist nie nur Lichterscheinung, nur Illusion eines objektiven Vorgangs. Es ist weniger Bild einer Sache als einer konkreten, nachvollziehbaren Erfahrung. Wir beobachten nicht nur die Flamme, sondern auch das Sehen dieser Flamme, ihr Betrachten und Spüren durch den Körper dessen, der uns nun durch den Film daran teilhaben lässt. Der Künstler vertraut nicht allein dem elektronischen Bild als immaterieller Erscheinung, er versucht, ein wenig von der Berührung der Dinge, von der greifbaren Präsenz der Situationen zu übermitteln. Er möchte auch dort den Körper, seinen Körper, als etwas, das auf ganz eigene Weise erlebt und denkt, einbringen, wo eigentlich nur das stofflose Licht ist. Er erreicht das durch die Position der Aufnahme und durch die besondere Projektionsrichtung, nicht zuletzt aber auch durch die Fläche, auf der das Bild erscheint. Die Lichtstrahlen werden nämlich von einem ungewöhnlichen Material reflektiert, das einen leicht irisierenden Effekt hat. Projiziert wird auf eine glattgestrichene Salzfläche. Dieser Stoff taucht schon früh in Bałkas Arbeiten auf und ist in ihnen untrennbar mit dem menschlichen Körper verbunden. Salz als lebensnotwendiges Element; Salz als eine besondere Form von Weiß, von Reinheit; aber auch Salz als der getrocknete Rückstand des Lebens: Schweiß und Tränen. Wie hier als Projektionsfläche ausgelegt, hält sich dieser besondere Stoff jedoch im Hintergrund und liefert nur das Maß an spürbarer Materialität, das notwendig scheint, damit das Licht-Bild in unserem Körperraum etwas mehr Halt findet als gewöhnlich.
Die Haftung des Bildes im Raum wird aber gleichzeitig angegriffen durch die seltsame Wirkung, die bewegliche Bilder auf dem Boden haben. Sie schaffen Unruhe auf dem Grund, auf dem wir stehen. Sie neigen dazu, eine feste Annahme unserer Wahrnehmung ins Wanken zu bringen. Und an dieser Stelle muss spätestens auch davon die Rede sein, dass hier zwei Bilder zu sehen sind. Es ist der gleiche Film, der zweimal nebeneinander projiziert wird. Die Flammenkränze ‚tanzen‘ synchron und doch entsteht zwischen ihnen eine besondere Irritation. Das eine Bild wirkt nicht als mechanische Wiederholung des anderen, sondern beide suggerieren zusammen ein neues Bild: BlueGasEyes, wie es der Titel nennt. Das Augenschema drängt sich auf, nicht nur wegen der Doppelung der leuchtenden Kreise, sondern auch weil zwischen ihnen ein ständiger Wechsel von Gleichheit und Abweichung zu spielen scheint, weil Augen nur als Paar leben, und jede Entfernung des einen vom anderen Zerstörung ankündigt, Bruch mit der Welt.
BlueGasEyes ist schon als Wortfolge ein Oxymoron, eine willentlich herbeigeführte Verbindung von Gegensätzen, von Widersprüchen, eine schmerzliche Koppelung von Dingen, die man sonst getrennt hält. Das Blau, das Gas, die Augen, wie gehört das zusammen? Hinter der scheinbar nüchternen Aufzählung visueller Zeichen – und durch die Klänge einer romantischen Liedzeile hindurch – spürt man eine andere Dimension. Nicht nur mit Blick auf den Titel der Ausstellung und andere Arbeiten in ihr verlieren die drei Wörter ihre Unschuld. Gas ist nach dem 20. Jahrhundert nicht mehr nur in der Küche zu Hause, es ist eines der Synonyme für die große Vernichtung, für den Holocaust, geworden. Gas ist eines jener Wörter, das wir gebrauchen, weil wir die Sache nicht fassen können (oder wollen). Und die blauen Augen? Fast unheimlich nah am Bild des Films sind Zeilen von Paul Celan, den man hier erwähnen darf, weil Bałka ihn im Titel der Ausstellung zitiert. „Dies ist das Auge der Zeit: / es blickt scheel / … / sein Lid ist von Feuern gewaschen“. Die berühmteste Zeile des Dichters schließlich, so oft gebraucht, dass man kaum noch zu ihr vordringen kann, und womöglich nur von einem polnischen Künstler zu lesen, dem die deutsche Sprache immer wieder sehr bekannt vorkommt, lautet: „der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau“.
The Wall
Man sieht, was man sieht, nämlich beinahe nichts oder eben nur ein Stück Wand, ihre Oberfläche ist etwas rau, hier und dort ein wenig verschmutzt. Eine Wand, mit der man schon eine Zeit lang gelebt hat. Dann und wann verändert sich das Licht auf ihr ein wenig; vielleicht ziehen draußen Wolken vorbei. Das, was aber wirklich auffällt, ist die unstete Bewegung dieses Bildes einer Wand. Der Blick auf die Fläche ist nicht fixiert, sondern gleitet ganz unregelmäßig mal etwas zur Seite, mal nach oben oder unten. Die Bewegung ist nicht gezielt, sondern unwillkürlich: Der Arm, der die Kamera hält, ermüdet. Das träge Schwanken, das zögerliche Umherirren des Blicks wird noch verstärkt durch die Art der Projektion. Das Video erscheint deckungsgleich auf einer Wand, die frei im Raum steht. Die Verdoppelung und Überlagerung des Motivs rückt das Filmbild in den realen Raum hinein. Doch ist es weniger die Wand selbst, die zum Körper wird, als die körperliche Erfahrung des ununterbrochenen Starrens auf die Wand, die uns entgegentritt.
Der Blick auf die leere Wand könnte ein Ausdruck von Langeweile sein, das Bild einer Zeit, die einfach nur vergeht, die man totschlägt. Aber die Belanglosigkeit dieser Fläche, die Dummheit dieses Gegenstandes schaffen auch einen Freiraum für das Sehen, in dem es unweigerlich und ohne Vorgaben in eine Form des Denkens hinübergleitet, die vor oder nach ihm kommt, das Sinnen. Es ist nicht frei von Melancholie oder Vergeblichkeit, es ist eine gleichsam vegetative Form des Nachdenkens, eine Pause im willentlichen Teil des Lebens, eine Einfallsöffnung für neue Vorstellungen ebenso wie für die immer wieder gleichen Dinge, die einen nicht loslassen. Nicht von ungefähr erscheint The Wall in dieser Ausstellung neben BlueGasEyes: ein Nachwort, ein Resonanzraum, eine Befreiung?
wydawałoby sie
Im Dämmerlicht sammeln sich in einer Mauerecke die Insekten. Hunderte von ihren krabbeln vom Boden bis zur Decke dort umher, scheinbar chaotisch und ohne Sinn. Warum sie dort sind und was sie dort tun, kann man nicht sehen. Erfahrung lässt einen vermuten, dass es Sommer ist und sich in solchen Winkeln abends der Tau sammelt, den die Tiere aufsaugen. Vielleicht befinden wir uns auf einem Balkon, denn im Hintergrund hört man die Geräusche eines Hauses: Schritte, Türen und Stimmen. Die Kamera, die diesen Moment festhält, fährt immer wieder langsam die Mauerecke entlang, hinauf und hinunter, hinunter und hinauf. Sie bewegt sich nicht gleichmäßig, die Senkrechte präzise nachzeichnend, sondern folgt der Linie mit freier Hand, nach links oder rechts leicht abweichend, manchmal stockend, mal ein wenig schneller, mal wieder langsam, bisweilen wird das Bild unscharf oder droht, für kurze Zeit in einem Schatten zu verschwinden. Allmählich registriert man unter den Geräuschen auch ein regelmäßiges, aber etwas gepresstes Atmen ganz in der Nähe. Der, der hier filmt, muss sich konzentrieren, um der Linie zu folgen. Das unablässige, beinahe mechanische Abtasten der Situation hat etwas von einer rituellen Übung, so als ob man schon durch ständige Wiederholung tiefer in das Geschehen eindringen könnte.
Die Stimmen im Hintergrund kommen aus einem Fernsehgerät. Mehr oder weniger deutlich hört man nach einiger Zeit einen bestimmten Typ von Sendung heraus. In einer Mischung aus Berichterstattung, Originaltönen und Musik dringen Bruchstücke einer Geschichte durch. Es geht um einen unerklärlichen Mord. Ein Junge hat auf dem Nachhauseweg ein Mädchen mit einem Stein erschlagen. Genaues erfährt man kaum, nur ein paar eher hilflose Beschreibungen und Vermutungen. Das Warum bleibt im Dunklen, die Ratlosigkeit zieht sich in den Satz zurück: Jemand, der Tiere mag, muss doch auch Menschen mögen, oder?" Man kennt solche Sendungen, eine ganze Branche lebt von der Faszination und dem Unterhaltungswert des Verbrechens: Das Allgemein-Menschliche in seinen dunklen Momenten als Zeitvertreib. Aber darum geht es in wydawałoby sie (Es schien als ob) nicht. Es ist die Verknüpfung konkreter und losgelöster Details einer alltäglichen Situation, aus der der Film ein neues Bild macht. Er nimmt sein Material gleichsam wörtlich: Insekten auf der Wand, Stimmen aus dem Fernsehen. Die neue ‚Geschichte', die hier entsteht, kommt aus einer unvorhersehbaren Übertragung, die zwischen den beiden Fundstücken hin- und herläuft.
Die eigentliche Verknüpfung der Elemente geschieht außerhalb des Films im Raum selbst. Die Projektion erfolgt nämlich in eine eigens errichtete, freistehende Wandecke hinein. Das Filmbild erfährt so eine räumliche Verdoppelung, ist zu den Rändern hin aber verzerrt. Der Blick konzentriert sich so noch stärker auf die Mitte, auf die Senkrechte des Winkels und auf die Unzulänglichkeit der Kamera, dieser Linie zu folgen. Die Anstrengung in der suchenden Bewegung erscheint beinahe wie ein Reflex der Schwierigkeiten, das angedeutete Verbrechen zu verstehen. Gegenüber der Projektionsfläche steht eine Bank mit hoher Lehne, die ebenfalls im rechten Winkel gebaut ist und den Erlebnisraum der Arbeit abschließt. Sie bietet zwei Personen Platz, die so nah über Eck zusammensitzen, dass sich ihre Knie leicht berühren. Ganz nah hinter ihnen in der Rückwand befinden sich die Lautsprecher für den Ton des Films. Noch einmal ist es also eine Ecke, die die Struktur der Arbeit bestimmt. Der Zusammenschluss zweier Wände ist banal und definiert dennoch etwas, das nicht nur sprachlich ins Abseits gerückt ist. Gaston Bachelard hat die Ecke „die Geometrie einer dürftigen Einsamkeit“ genannt, sie „verweigert das Leben, verengt das Leben, versteckt das Leben“. Ecken und Winkel sind Orte einer bergenden, aber auch bedrohlichen Intimität. Sie schaffen eine Nähe zu sich selbst und zu Anderem, aber diese Berührung garantiert kein Verstehen, nur eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Der Winkel, in dem sich die Insekten sammeln, und die vermittelte Intimität des Verbrechens gehen eine fragile Beziehung ein. Von beidem wissen wir mir wenig und glauben uns ihm dennoch nah.
T.Turn
Es braucht eine Zeit lang, bis man sich in den stockenden, verzerrten Bildern des Films zurechtfindet, bis man den rücksichtslosen Schwenk als komplette, aber schlingernde Drehung ausmacht, die hier in Zeitlupe vorgeführt wird. So als sei die Kamera nur verrissen worden und hätte auf ihrer irregulären Bahn ein inoffizielles Panorama erfasst. Die Folge der Bilder erscheint zuerst disparat, die Fetzen der Welt, die man hier sieht, rotieren nicht nur, sie scheinen auch gleichsam ineinander zu kippen. Oben und unten, rechts und links verlieren ihre Eindeutigkeit. Wie bei einem Möbius-Band kehrt die Bewegung gewendet in sich selbst zurück. Der Schwenk ist aber nicht konstruiert, sondern folgt dem natürlichen Kreisen des Arms um den eigenen Körper, den eigenen Kopf herum. Der Blick des Filmenden und der Fokus der Kamera trennen sich. Der Film zeigt nicht das, was das Auge unmittelbar sieht, sondern etwas, das der Körper wahrnimmt, einen Umraum im wahrsten Sinne. Die Bilder sind nicht objektiv, sie haben keinen festen Standpunkt und sie tasten die Welt auch nicht rational und kontinuierlich ab. Sie tun nur das, was möglich ist, wenn man die Kamera auf diese Weise bewegt und wenn man mehr erfahren will als man sehen kann. In dieser Wahrnehmung steckt etwas von einer Trance, und die Projektion auf den Boden erhöht zusätzlich das Gefühl des Schwindels. Die Entrückung ist jedoch nicht vom Wunsch nach Flucht bestimmt, sondern vom Verlangen nach Ankunft an dem Ort, um den es hier geht.
In der Drehung des Films gibt es zwei Stellen, die beinahe wie entgegengesetzte ‚Szenen' wirken. Einmal gleitet der Blick flüchtig über eine Gruppe von Menschen auf einer Wiese. Ein andermal erscheint eine schwarze Wolke mit einem grellen, gezackten Lichtloch. Sie kommt genau zu dem Zeitpunkt ins Bild, wenn die Welt, der Bewegung des Arms folgend, kippt. Der Rest sind Waldränder, Himmel, vielleicht ein Weg. Im einen Augenblick streift der Blick die Andeutung einer Idylle, eine pastorale Sekunde lang, im anderen dringt ein bedrohlicher Kontrast, ein dramatisches Signal in den Ablauf. In ähnlicher Weise treten Bild und Ton auseinander. Wo der dynamische, unregelmäßige Schwenk den Ort in Aufruhr versetzt, legen sich die Stimmen ruhig und wie von Ferne über die Szene. Die gelassene, wenn auch verhaltene Ausflugsstimmung, die wir hören, befindet sich in einer seltsamen Allianz mit der revoltierenden Bewegung, die wir sehen.
T.Turn: T steht für Treblinka. Von dem ehemaligen Vernichtungslager nordöstlich von Warschau in der Nähe des Flusses Bug existiert nicht mehr viel. Ein großer Teil ist von Wald bedeckt. Dort wo das eigentliche Todeslager, wo die Gaskammern waren, ist heute eine weite, offene Fläche mit einem Mahnmahl. Das Auto braucht eine gute Stunde von Otwock bis hierhin. Es ist ein Ausflug an einen Ort, an dem man etwas sehen und dadurch verstehen möchte. Es gibt kaum noch Menschen, die den Ort unter, hinter dem heutigen Ort kennen, weil sie damals dort gewesen sind. Die anderen, wir, können uns Informationen zusammenklauben, wir können uns vor Ort die Dinge erklären lassen (die hebräisch sprechende Stimme des Guides im Hintergrund). Wir sind da und wir sind nicht da. Den Fuß an diesen Ort zu setzen, sich auf die Wiese zu legen und einmal und wieder einmal ganz rundherum zu blicken, wie das Bałka mit dem Film tut, ist nicht der Versuch, die vergangene Zeit des Ortes zurückzuholen oder sich für einen Moment in sie hinein zu versetzen, denn das geht nicht. Es ist vielmehr der unwahrscheinliche Bericht über einen neuen Ort, der zwischen der Berührung dieser Stelle und unserem Wissen, zwischen dem Verlust und unserer Gegenwart entsteht. Es ist ein unbefriedigender, aber richtiger Ort, eine paradoxe, aber notwendige Erfahrung. Ein dreißigsekündiger Schwenk ohne Ende.
The Fall
Das Spektakel vollzieht sich im Dämmerlicht. Schwarz, Weiß, Grau, manchmal meint man auch ganz dunkle, schmutzige Grüns und Brauns zu erkennen, so als würden wir das Geschehen durch einen Filter betrachten. In Leserichtung läuft immer wieder ein x-mal variierter Vorgang ab. Aus dem oberen Teil des Bildes fallen, von einer hellen Perlenreihe nur zeitweise aufgehalten, leichte Massen wie Sand oder Staub herab. Sie fallen unregelmäßig und mit wechselnden Geschwindigkeiten. Mal sind es Abstürze, mal dramatische Wirbel, mal dünne Rinnsale, die sich durch die instabile weiße Kette ihren Weg nach unten bahnen. Dort wiederum wächst eine Landschaft in weiten, ruhigen Wellen an. Wo die eine dieser beiden Welten abnimmt, nimmt die andere zu. Das Spiel geht immer weiter; nach ein, zwei Minuten bricht es recht ab, und für einen kurzen Moment liegt eine beruhigte Szene vor einem. Gleich darauf jedoch ballen sich die dunklen Massen mit ihrer prekären Konsistenz wieder im oberen Teil des Bildes, um erneut, langsam oder abrupt, mit ihrem Fall zu beginnen. Es steckt eine seltsame Zwanghaftigkeit in dieser Ab- und Zunahme, in diesem Vergehen und Werden, in diesem vorhersehbaren, aber immer anders sich ergebenden Austausch der Welten.
Unwillkürlich schieben sich in die Betrachtung des großen Bildes die Metaphern von Landschaft, Natur und Kosmos. Hier ein Regenschauer oder eine geologische Schichtung, dort eine Düne oder eine Gerölllawine. Und spielt sich das Ganze nicht vor einer hellen Leere ab, die man für das Nirgendwo des Weltalls nehmen könnte? Das eigentümliche Ringen von Schwerkraft und Auftrieb, das die dunkle Materie durch die nach oben entweichenden Bläschenperlen sinken lässt, hätte aber ebenso in einer Unterwasserwelt Platz. Und nur noch ein Schritt weiter und das Szenario wird zum Bild des Untergangs einer alten und der Entstehung einer neuen Welt. Oder man denkt an ein chinesisches Tuschebild, das mit wenigen Andeutungen eine perfekte Einheit von konkretem Naturdetail und kosmischem Sinn zu schaffen versucht.
Solche Blicke auf und durch das sich bewegende Bild hindurch stehen jedem frei. In all die Assoziationen und Deutungen mischt sich jedoch eine bestimmte Irritation. Was hier abläuft, scheint einerseits von unendlicher Weite und Realität zu sein, andererseits wird man den Eindruck nicht los, eine modellhafte, eine künstliche Welt zu sehen, so als wäre es eine naturwissenschaftliche Versuchsanordnung, womöglich sogar ein Vorgang, den man unter einem Mikroskop betrachten kann. Auch das kulissenhafte und die rührenden Effekte der frühen Filmgeschichte scheinen bisweilen durch. Was den Betrachter in eine reale Welt zu entführen scheint, könnte nur ein illusionistischer Trick sein. Was wie das ganz Große aussieht, könnte in Wirklichkeit das ganz Kleine sein. In der Tat: Was hier ohne großen Aufwand gefilmt wurde, ist ein Spielzeug, ein Souvenir von einem Besuch an der See. Zwischen zwei Glasscheiben befinden sich in einer durchsichtigen Flüssigkeit etwas Luft und eine bestimmte Menge feiner Sand. Hält man den kleinen Rahmen vor das Licht und dreht das transparente Bild auf den Kopf, kann das Schauspiel im Miniaturformat beginnen. Nicht nur Kinder, aber die besonders, können stundenlang und immer wieder einmal in solche Zauberwelten eintauchen. Die kleinste und belangloseste Form (ein Teppichmuster, ein Fleck auf der Wand) können zum Ausgangspunkt einer Gedankenwanderung werden, und noch nach Jahrzehnten erinnert man sich an solche irrealen, aber intensiven Bilder und Momente. Auch der wiederholte Wunsch zu prüfen, ob der Trick noch funktioniert, ob man den Schlüssel zu dieser Traumwelt noch besitzt, gehört zu solch einer heimlich-unheimlichen Erfahrung mit der eigenen Vorstellungskraft. Die Intimität dieser Blicke auf etwas ganz Nahes, die Abschortung der Aufmerksamkeit auf einen ganz kleinen Raum, stößt in paradoxer und wundersamer Weise eine Tür in eine große Welt, in die Welt auf. Es ist eine sublime Erfahrung, da derjenige, der sie macht, mit einem Teil von sich selbst in der Überschaubarkeit des Gewohnten und Sicheren bleibt, während er sich mit einem anderen Teil in der Offenheit und den Abgründen einer unkontrollierbaren Gegenwelt bewegt.
Die große Wandprojektion The Fall spielt die Wunder und die Mechanik solcher Erfahrungen aus. Sie bedient sich des Charmes der frühen bewegten Bilder, die wir heute belächeln oder gerade wegen ihrer effektvollen Einfachheit und ihres wachen Illusionismus jenseits aller digitalen Animation wieder schätzen. Direkt unter der Projektion aber verläuft ein Holzbord, das dem flüchtigen Bild einen gewissen Halt im Raum des Zuschauers gibt. Diese Geste verleiht der Lichterscheinung etwas Körperliches, sie bietet der Illusion einen Platz in der haptischen Realität an. Dahinter steckt womöglich ein gewisses Misstrauen diesem „immateriellen" Medium gegenüber, was bei einem Bildhauer, der mit der Vergangenheit und der Dauerhaftigkeit des Materiellen lebt, nicht abwegig ist. In diesem Film über eine kosmische Imagination von Untergang und Werden und Untergang ist das Brett Teil jener Ablenkungen und Brüche, die auch den Film selbst durchziehen und die aus ihm eben nicht ein Stück gelungener Täuschung, sondern eine zutiefst visuelle Reflexion über das Wunderbare und das Sich-Wundern machen.
The 3rd Eye
Das dritte Auge ist die Kamera, ein zusätzliches Sehinstrument mit dem Versprechen, mehr zu erkennen. Der technische Apparat wird von der Sprache zum Organ befördert, die Wölbung und der Glanz der Linse lassen das Gerät zu einem Körperteil werden. Der Blick durch das Objektiv hat seit vielen Generationen eine seltsame Verschmelzung zwischen unseren zwei Augen und jenem anderen herbeigeführt, das wir uns aus eigener Kraft verschafft haben. Mitunter scheint die Kamera so mir dem Körper verbunden, als ob er es selbst wäre, der durch den Film hindurch agiert. Ganz unmittelbar erlebt man in diesem Video durch den Blick der Kamera die wankenden Bewegungen des Körpers, der sie hält. Die gedachte stabile Linie zwischen dem Auge, dem Sehgerät und dem Gegenstand wird von einer Kraft in Bewegung versetzt, die das ganze Gefüge des Sehens erfasst. Die Situation ist geläufig: Es sind die schlingernden Bewegungen eines Zuges, die den Körper ständig seine Balance suchen und den Blick unruhig umherwandern lassen, nicht zuletzt dann, wenn man nach unten auf den Boden blickt. Gerade dort, wo man den festen Grund erwartet, liegt die Ursache des Schwankens. Das monotone, nur leicht modulierte Rattern und Zischen der Räder auf ihren Schienen hört man selbstverständlich mit, auch wenn es nicht zugespielt würde.
Wiederum wird das Videobild, etwa in realer Größe, auf eine Salzfläche am Boden projiziert. Der Versuch des Filmenden, die kreisrunde Form des Gegenstandes zu zentrieren, hat auf Dauer eine leicht hypnotisierende Wirkung. Die undeutliche Spiegelung in der Mitte, in der man ein weiteres Bild erwartet, aber nicht erkennt, tut ein übriges, um die Wahrnehmung in einen Wachschlaf zu versenken. Der Gegenstand ist offensichtlich aus Metall, eine Schüssel mit einem runden Einsatz. Der gewölbte Rand und der schmale dunkle Ring rundherum suggerieren aber auch ein Auge. Wenn man nur lange genug hinsieht, vermischen sich die Eindrücke: Aus dem harten, technischen Objekt wird ein weiches, lebendiges Organ. Der gewölbte Rand gerät zum Lid, die blitzenden Lichter unter dem dunklen Ring zur Augenflüssigkeit und der Reflex im Zentrum zur hellen Spiegelung auf einer Pupille. Und schließlich schlägt die unstete Bewegung der Kamera um: Aus ihr wird das nervöse Umherblicken eines Auges, das zurücksieht.
Unter all diesen Suggestionen hat man den realen Gegenstand der Aufmerksamkeit natürlich schon längst erkannt. Was hier gefilmt wurde, ist die Kloschüssel in einer Eisenbahn. Fast jeder hat seine Erfahrungen mit dieser Situation, wo das Natürlichste unter erschwerten Bedingungen vollzogen werden muss. Aber um diese besonderen Umstände, um die konkrete Ausgestaltung allbekannter Erlebnisse geht es hier nicht. Man erkennt die Schüssel zwar noch, aber sie wird zu einem viel allgemeineren, zu einem verstörenden Bild. Das Auge, das lebt, weil es sieht, ist gleichzeitig ein Loch, ein Abgang, ein Ende: Abort. Jederzeit könnte sich der Einsatz öffnen, ins Nichts aufreißen und eine Welt außerhalb und unterhalb der eigenen auftun. Der Blick in die banale Schüssel enthüllt ein Königsorgan des Menschen und droht gleichzeitig zum Bild des anus mundi zu werden, des letzten Ortes, den man sich ausdenken kann. Der Schriftsteller Wieslaw Kielar hat seinen Bericht über Auschwitz so genannt, und das lateinische Wort stammt von einem der Schlächter selbst. Und ist in der Spiegelung im Zentrum des Schüssel nicht auch das Gesicht des Filmenden zu sehen, ein Selbstportrait mithin?
Lichtzwang
Die Filme beginnen ständig wieder von vorne; meist merkt man es gar nicht. Sie laufen mit einem eigenen Rhythmus ohne Ende weiter, fast wie ein Ritual, in dem nicht nur der Inhalt, sondern auch die Dauer und der Takt zählen. Der ‚loop‘ ist hier weniger eine pragmatische Konvention des Ausstellungsbetriebs als ein Mittel, den Betrachter in eine eigentümliche Zone zwischen Sehen und Denken hineinzuziehen. Was ihm gezeigt wird, sind einfache Aufzeichnungen von kleinen Vorgängen und Situationen. In diesem Sinne herrscht ein nüchterner Dokumentarismus. Alles Erzählerische bleibt außen vor oder fällt höchstens vom Rande her ein. In den Szenen und Zuständen, die in den Videos aufscheinen, breitet sich vielmehr eine bestimmte Intimität aus. Der zugleich gerichtete und sich verlierende Blick sowie die körperliche Nähe zu den Dingen schaffen eine, allerdings brüchige Vertrautheit. So als könnte sich das Gesehene von selbst erklären, wenn man nur nahe genug herankommt und seine Gegenwart nur lange genug aushält. Dieser Wunsch ist den Bildern eingeschrieben, und gleichzeitig zeigt jedes Bild die Unmöglichkeit, so einfach zum Erkennen vorzustoßen. Das Gelände zwischen den Tatsachen, den Blicken und dem Wissen bleibt dennoch das Operationsfeld dieser Kunst des Sichtbaren. Auf der Suche nach den Lücken, die ein kleines Stück mehr von den Zusammenhängen sehen lassen, muss es immer wieder neu abgeschritten werden.
Dabei stößt Bałka auf Überraschendes wie auf Banales, auf Poetisches wie auf Unerträgliches. Gerade das, was grundsätzlich zu groß, zu komplex, zu schrecklich erscheint, als dass man es mit einfachen Sätzen und Bildern erläutern könnte, zieht ihn an. Dazu gehören die Vergangenheit und die Fallstricke der Erinnerung, das Verbrechen, der Tod, aber auch die schiere Schönheit und die kleinen Wunder. Das Eine ist aber nie ohne das Andere zu haben, ja, gerade die Videoarbeiten scheinen eine dritte Ebene zwischen dem vermeintlich Eindeutigen zu suchen. Wenn einen wie in den strahlenden Feuerkränzen das menschliche Auge und zugleich das Gas anblicken, wenn die Schönheit solch eine Schärfe und das Grauen solch eine Verführungskraft annehmen, fällt man in eine reale Ausweglosigkeit. In den Gesprächen vor der Ausstellung verwies Bałka auf eine Liedzeile, in der es heißt „As I search for a piece of kindness / And I find Hitler in my heart“. Einen solch unerträglichen Zwiespalt in einem Kunstwerk anzupeilen, ihn für einen Moment an diesem Ort wahrscheinlich zu machen, ist ein Wagnis. Die Missverständnisse werden nicht auf sich warten lassen und die Gefahren ebenso wenig. Aber genau an diesen Punkt müssen Werke führen, denen es um alles geht, die aber nur ganz wenig zeigen (können). Was die Arbeiten vor falscher oder vergeblicher Empathie oder gar vor einer heillos dunklen Romantik bewahrt, ist ihre Form. Sie stellt sich als eine zeitgenössische Nüchternheit dar, so beiläufig wie genau. Es geht darum, abzuwarten und dann, wenn eine Situation eine gewisse Dichte erreicht, sie eine Zeit lang zu beobachten. Was solch eine nüchterne, aber wache Zurückhaltung von einer geläufigen ,Coolness‘ unterscheidet, ist ihr Blick auf die Vergangenheit. Vergangenheit nicht als Verfügungsmasse und auch nicht als etwas, das nur in den Ereignissen steckt, sondern in allem, „das Ich berühren kann“, wie Bałka sagt. Vergangenheit ist Physis und Physis ist Vergangenheit – also Gegenwart.
Das Licht in den Filmen bleibt in der Nähe der Dunkelheit: „Klopf die / Lichtkeile weg“ (Paul Celan). Es sind die Zwischenzonen des Dämmerlichts und der vermeintlichen Undeutlichkeit, aus denen heraus die Arbeiten operieren. Die Helligkeit ist kein Garant für Aufklärung, unter gewissen Umständen muss man sie eher meiden. „Doch konnten wir nicht hinüberdunkeln zu dir: / es herrschte / Lichtzwang“ (Paul Celan). Das halbe Licht ist eine Form, die mit dem Abstand korrespondiert, der zwischen der Beobachtung und ihrer Bedeutung herrscht. Es beleuchtet gerade soviel, dass die Richtung für ein Verständnis sichtbar wird, aber ebenso der Zweifel, ob man wirklich dorthin gelangen kann. So nah sich die Arbeiten an der spürbaren Oberfläche der Dinge und Themen entlang bewegen, so fern und fremd machen sie sie auch. In diesem Zwischenraum ist kein Aufenthalt, keine Ruhe, keine Gewissheit, nur der notwendige Drang, noch einmal hinzusehen und vielleicht in einem anderen Lichtfleck ein anderes Detail des noch Unverstandenen zu erblicken.
(Published in: Mirosław Bałka - Lichtzwang. K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Snoeck Verlagsgesellschaft, Cologne 2006, pp. 3 – 31 (German), 32 – 37 (English))